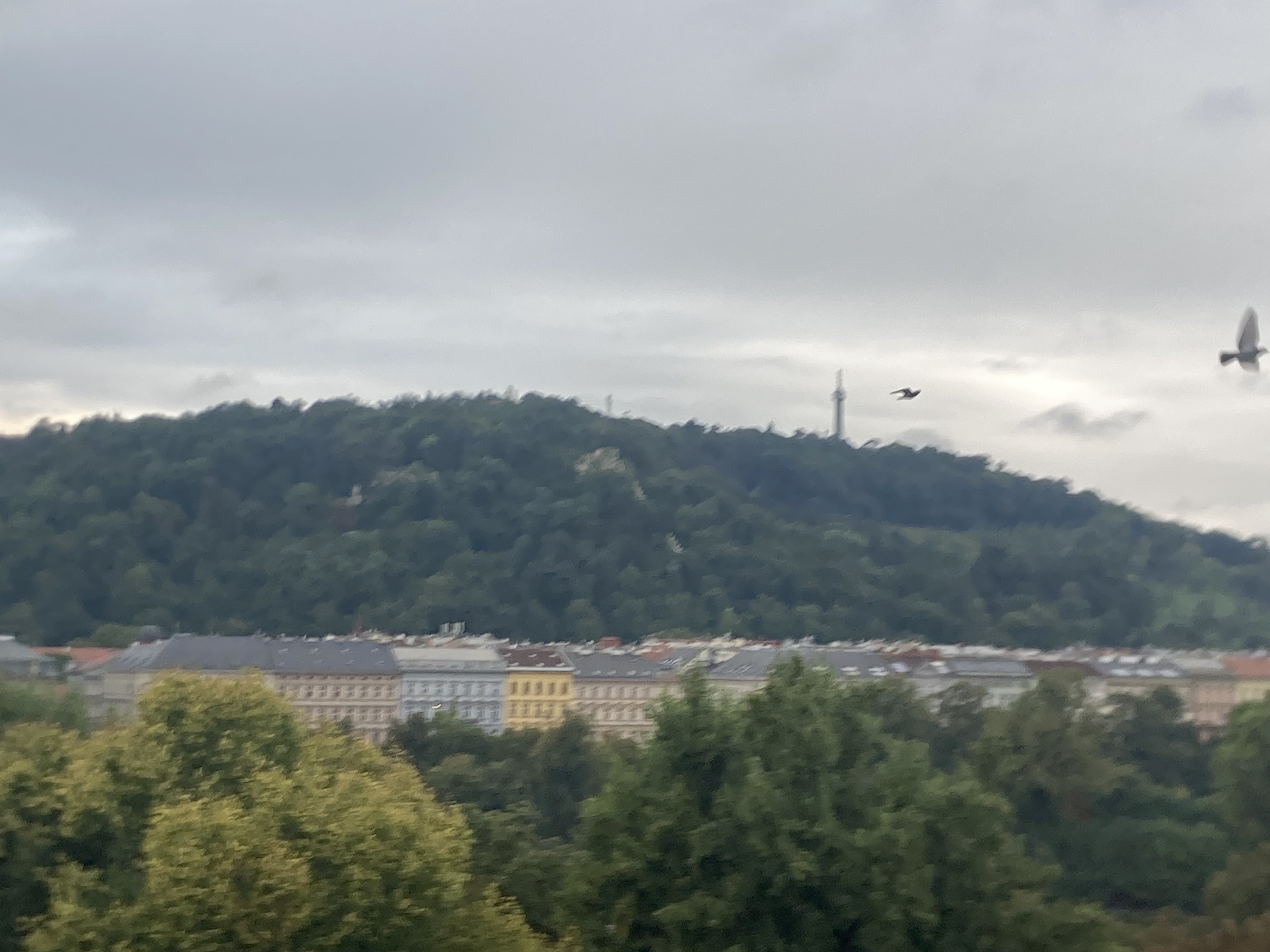Kaum hatte ich die Wohnung betreten, zog es mich wie von einem Magneten an das Fenster. Die schwere Reisetasche ließ ich achtlos im Flur fallen – ich musste sofort hinausblicken, als ginge es um eine dringende Rettungstat. Da lag sie, unmittelbar und überwältigend: die Moldau, von oben gesehen, vom vierten Stock an der Masarykovo nábřeží. Ein Panorama, von dem ich noch nicht wusste, dass es mir bald alltäglich werden würde. Zum ersten Mal strich mein Blick langsam darüber: von dem Turm der Galerie Mánes hinüber bis zum fernen Petřín-Turm auf der Höhe des Hügels, bis schließlich zur Burg, auf die ich seither Tag für Tag minutenlang verweile. Beugt man sich weit genug hinaus und wendet den Kopf nach rechts, blitzt sogar die Karlsbrücke auf – doch wage ich es selten, aus Angst, dass mich die Schönheit in die Tiefe ziehen könnte.
Also halte ich mich fest am Fensterrahmen, damit ich nicht falle, und beginne mein Ritual. War es schon am ersten Abend? Vielleicht am zweiten. Da diese Melodie ohnehin in meinem Kopf kreiste, folgte ich einer spontanen Eingebung: Smetanas „Vltava“ hören, mit Kopfhörern auf den Ohren, während ich die „wirkliche“ Moldau betrachte – mit ihren Wellen, mit ihren Vögeln. Diese Vögel! … die allein oder in Schwärmen den Himmel zerschneiden, das Horizontband herausfordern oder sich leise aufs Wasser setzen. Wenn ich wiederkehre, will ich über diese Vögel schreiben!
Ich suchte im Internet nach „Vltava“ und fand zuerst eine kurze Aufnahme, dirigiert von Daniel Barenboim mit den Berliner Philharmonikern – eine perfekte Brücke zwischen meinen beiden Welten. Von Berlin war ich gerade gekommen, dort lebe ich seit vierzehn Jahren. Vor vierzehn Jahren verließ ich Prag, wo ich fast sieben Jahre verbracht hatte, und ging nach Berlin – so, wie man eine Liebe für eine andere verlässt: im Wissen, dass ich gehen musste, und doch gewiss, dass ich Prag für immer lieben würde.
Nach all diesen Jahren ist dieser Monat ein Geschenk: nicht nur für mein Buch, das hier, unter besten Bedingungen, wächst, sondern auch für das Wiedersehen mit einer alten Liebe. Ich schwanke zwischen Verwirrung (Warum bin ich damals eigentlich gegangen?), Befriedigung (Wie schön, dass ich zurückkommen darf! Und dass ich den Schlüssel noch immer in der Tasche habe: die tschechische Sprache, die ich nicht vergessen habe.) und reiner Begeisterung (Wie kann eine Stadt nur so schön sein!!?).
Diese Begeisterung nährt mein tägliches Ritual: morgens, beim Erwachen, das Fenster öffnen, tief atmen, Kopfhörer aufsetzen, „Vltava“ hören – immer wieder in anderen Fassungen. Nach der Berliner Philharmonie folgten die Tschechische Philharmonie, das Prager FOK-Sinfonieorchester; und an einem Putztag hörte ich sogar eine Radiosendung, die die ganze Geschichte dieser Tondichtung erklärte: wie sie an den unscheinbaren Quellen beginnt, dann Wälder und Felder durchströmt – im Vorübergleiten ein entferntes Hochzeitslied aufnimmt – und schließlich in strahlendem Glanz auf dem Vyšehrad, auf Prag, ankommt.
Wenn die Moldau „in Prag angekommen“ ist, verstummt die Musik – und ich bin voller Energie. Am Morgen ist das ideal: der Tag darf beginnen, das Buchprojekt ruft, hier oder im Café um die Ecke. Am Abend aber ist es anders. Dann muss ich diese Energie in Ruhe verwandeln, in die Gelassenheit, die zum Schlaf führt. Und da gibt es ein Schauspiel, das mich sanft beruhigt, wenn ich rechtzeitig ans Fenster trete. Schon am zweiten oder dritten Abend bemerkte ich es: Punkt Mitternacht erlöschen die Lichter der Burg. Dann lehne ich mich ein wenig hinaus – nicht zu weit, gut festgehalten – und starre die Burg an. Auf keinen Fall den Blick abwenden, um den Moment nicht zu verpassen. Ich warte, und dennoch überrascht es mich immer wieder: das Licht erlischt, die Burg verschwindet. Gute Nacht, Prag.